
Toyota-SUV der 1990er. Wäre es aus Nachhaltigkeitsgründen besser, dieses Fahrzeug gegen ein brandneues Stück zu tauschen? Die Antwort ist nicht so eindeutig, wie manch einer vielleicht gerade vermuten mag.
Foto: stock.adobe.com © topalov.guide
Alte Autos: Rollende Nachhaltigkeit oder fahrende Umweltsünde?
Nicht erst seit Elektrofahrzeuge auf den Markt strömen, wird eine leidenschaftliche Debatte geführt: Ist es aus Sicht von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und ähnlicher Faktoren besser, ein einmal gebautes Auto möglichst lange zu fahren? Oder ist das Gegenteil der Fall – und nur ein Wagen mit modernstem Verbrauchs- und Abgasverhalten wirklich nachhaltig?
Was unter welchen Bedingungen für alte Fahrzeuge spricht
Eines sei an dieser Stelle bereits verraten: Ein eindeutiges Für oder Wider gibt es nicht. Neutral betrachtet liefert sowohl die Theorie des langjährigen Fahrens als auch die des Neufahrzeugs Argumente.
Werfen wir zunächst einen Blick auf das, was grundsätzlich für das Behalten älterer Fahrzeuge aus Sicht der Nachhaltigkeit spricht.
1. Die gesamte Produktions-Ökobilanz hat sich amortisiert
Egal, welches Produkt man sich anschaut: Sobald man es erwirbt, muss es erst einmal den bei der Fertigung entstandenen Fußabdruck buchstäblich „abarbeiten“. Bei einem Auto sind hierbei primär der Verbrauch und das Abgasverhalten gemeint. Dies bedeutet in der Praxis: Beides muss – unter gleichen Bedingungen – besser sein als bei einem zuvor genutzten Auto. Dadurch wird dieser Fußabdruck durch die Nutzung allmählich vermindert und wandelt sich dann irgendwann zu einem tatsächlichen Vorteil für den Planeten um.
Grundsätzlich setzt allein die Produktion eines Verbrenner-Autos – je nach Klasse und Ausstattung – zwischen 4 und 25 Tonnen CO2 frei (bei einem Mittelklasse-PKW sind es 8 bis 10 Tonnen). Je nachdem, wie viele Kilometer das Fahrzeug bis zur Verschrottung fährt, entspricht das etwa 15 bis 20 Prozent seines „Lebens-Ausstoßes“.
Ferner werden bei einem solchen, heutzutage etwa 1,5 Tonnen wiegenden Auto, etwa 70 Tonnen Materialien verbraucht.
Das alles bedeutet: Ein altes Auto hat, je nach Alter und Laufleistung, diesen Fußabdruck amortisiert. Es mag zwar mehr verbrauchen und mehr Schadstoffe ausstoßen als ein Neuwagen. Weil dieser jedoch überhaupt erst produziert werden muss, greift seine erhöhte Effizienz nicht von Anfang an, er muss diese erst „erarbeiten“. Das gilt genauso für vollelektrische PKW, zumal es bei ihnen noch davon abhängt, aus welcher Quelle sie ihren Strom beziehen.
Was noch hinzukommt: Da ältere Fahrzeuge typischerweise leichter sind und weniger üppig ausgestattet, war bei ihnen zumindest der Materialverbrauch deutlich geringer als bei modernen Autos.

Wenn ein Neuwagen beim Kunden ankommt, hat er bis zu 20 Prozent seines Lebens-CO2-Ausstoßes angehäuft. Das muss erst einmal durch Minderverbrauch und Abgasverhalten abgearbeitet werden – mitunter jahrelang.
Foto: stock.adobe.com © Gorodenkoff Productions OU
2. Ältere Fahrzeuge sind meistens deutlich leichter
Welche Faktoren sind für den Energieverbrauch eines Autos verantwortlich, wenn man solche Punkte wie die Streckenführung und Fahrweise außen vor lässt? Primär ist es eine Kombination aus
- Fahrzeuggewicht,
- Motorleistung,
- Geschwindigkeit,
- Motoreffizienz,
- Abrollwiderstand und
- Luftwiderstand.
Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wog ein durchschnittlicher Neu-PKW im Jahr 2022 1.696 Kilogramm. 1982 dagegen lag das Durchschnittsgewicht noch eine gute halbe Tonne niedriger. Ein wichtiger Grund dafür sind deutlich stabilere und dadurch Crash-sicherere Karosserien – aber ebenso merklich gesteigerte Ausstattungen.
An diesem Punkt sei auf das komplexe Zusammenspiel zwischen Gewicht und Verbrauch verwiesen. Grundsätzlich lässt sich deshalb folgendes sagen:
- Viele moderne Fahrzeuge haben ein so hohes Gewicht, dass dadurch die deutlich gesteigerte Effizienz ihrer Motoren (insbesondere hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs, weniger des Abgasverhaltens) negiert wird. Bei Benzinern war das diesbezügliche Effizienzmaximum Anfang der 2020er erreicht, bei Dieseln Anfang der 00er.
- Alte Fahrzeuge verbrauchen zwar konstruktiv meistens mehr. Die Motoren sind jedoch leistungsschwächer und müssen nicht so viel Masse in Bewegung bringen und auf Tempo halten.
Natürlich ist dies immer vom einzelne Auto und dessen Motorisierung abhängig. Dazu einige Zahlen zum Durchschnittsverbrauch neu zugelassener Fahrzeuge zur Verdeutlichung:
- 2004: Benziner 8,4 l/100km / Diesel 6,9 l/100km
- 2021: Benziner 7,7 l/100km / Diesel 7,0 l/100km
Das bedeutet im Prinzip: Alte Autos verbrauchen in der Praxis oftmals weniger, als es aufgrund der geringeren Effizienz den Anschein erweckt. Neue Autos hingegen verbrauchen nicht so wenig, wie es angesichts der technischen Weiterentwicklung möglich wäre.
Dazu ein Beispiel: In den USA sank der PKW-Durchschnittsverbrauch zwischen 1973 und 1991 von 17,5 auf 11,0 l/100km; macht also 6,5 Liter weniger in 18 Jahren. Von 1991 bis 2013 hingegen, also 22 Jahre, betrug die Reduktion hingegen nur noch einen einzigen Liter. Der Unterschied lässt sich fast ausschließlich durch die gestiegenen Abmessungen und Gewichte erklären.
3. Es gibt häufig weniger Elektronik, die ausfallen kann
Schon in den 1980ern hielt Elektronik im großen Stil Einzug in die Fahrzeugwelt. Allen voran in der Motorsteuerung. Jedoch war es in der großen Masse nicht einmal ansatzweise so viel Elektronik wie heutzutage üblich ist. Zudem waren diese Bausteine nicht miteinander vernetzt.
Wenn in einem heutigen Fahrzeug irgendwo ein Stück Elektronik ausfällt, kann durchaus das ganze Auto betroffen sein – und die Fehlersuche zeitaufwendig. Ein Beweis dafür: Ignoriert man die Starterbatterie, dann sind Elektronikprobleme seit Jahren der Pannenverursacher Nummer eins im PKW-Bereich.
Diese geringere Menge an Elektronik in älteren Autos korreliert mit einem weiteren Prinzip, das für diese Fahrzeuge spricht:
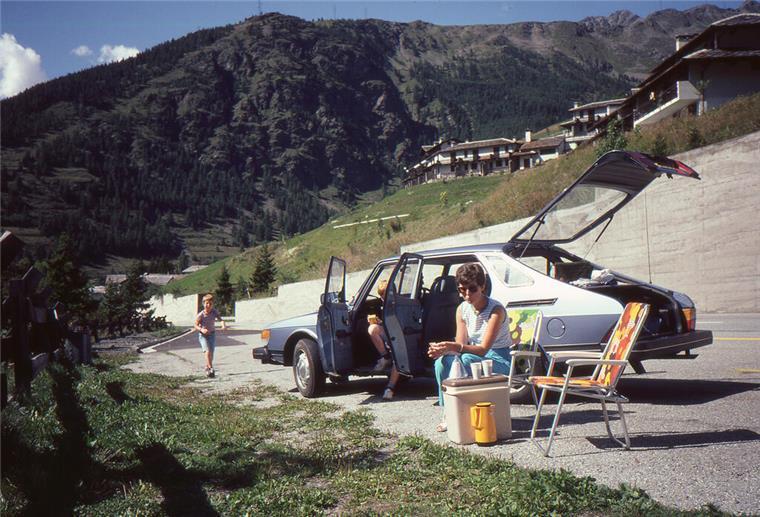
Im Direktvergleich innerhalb von Fahrzeugklassen sind alte Autos meist deutlich leichter. Der spezifische Kraftstoffverbrauch kann(!) deshalb überraschend gering sein – ähnlich wie die Verbrauchsdifferenz zu modernen Autos.
Foto: stock.adobe.com © Fortgens Photography
4. Reparatur statt Austausch ist nachhaltiger
Wir haben in den vergangenen Jahren eines gelernt: Aus Sicht der Nachhaltigkeit ist es immer besser, einen kaputten Gegenstand zu reparieren, statt ihn zu entsorgen und gegen ein neues Stück auszutauschen. Schlagen wir diesbezüglich zunächst einmal die Brücke zur Fahrzeugelektronik: Repariert wird hier bei modernen Autos nur in den seltensten Fällen etwas. Dazu wäre die Fehlersuche zu kostspielig. Ist beispielsweise in einem Steuergerät ein einzelnes Bauteil schadhaft, wird gleich das gesamte Steuergerät ausgetauscht – mit entsprechend schlechter Nachhaltigkeits-Rentabilität.
Dieser Grundgedanke lässt sich jedoch noch viel weiter ziehen: Die Reparatur einer kaputten Scheibe am Auto etwa ist stets die günstigere und nachhaltigere Herangehensweise. Fachfirmen tauschen deshalb nur aus, wenn es unumgänglich ist – etwa, weil ein Steinschlag sich im Sichtfeld befindet.
Und so sieht es bei fast jedem anderen Bauteil aus. Wer ein altes, noch verkehrssicheres Fahrzeug besitzt und es im Fall von Schäden reparieren lässt, ist nachhaltiger unterwegs als jemand, der einen Schaden zum Anlass nimmt, sich ein anderes Fahrzeug zu beschaffen. Dadurch entsteht ein weiterer Vorteil:
5. Jedes Altauto bedeutet einen nötigen Neuwagen weniger
Wer ein Auto besitzt, das noch fährt und sich im Schadensfall reparieren lässt, ist kein Kandidat für einen Neuwagen. Dieser Grundgedanke ist besonders heute wichtig, wo in vielen aufstrebenden Staaten die Zulassungszahlen stark ansteigen – also immer mehr Autos auf dem Planeten unterwegs sind.
Aus Nachhaltigkeitssicht wäre es wünschenswert, der gesamte Fahrzeugbestand würde sinken. Dahinter gibt es jedoch mehrere Abstufungen, die ebenfalls dem Planeten gut tun. Eine davon ist ein möglichst langsames Wachstum der Gesamtzahlen. Wer ein älteres Auto länger fährt, also keinen Neuwagen erwirbt, der trägt seinen Teil dazu bei. Insbesondere dann, wenn er den Wagen tatsächlich „bis Ultimo“ fährt – das Fahrzeug also danach recycelt wird. Nicht etwa weiterverkauft oder gar exportiert.

Je weniger Autos auf dem Planeten fahren, desto besser. Idealerweise würde deshalb der Kauf eines Neuwagens automatisch mit dem Verschrotten eines Altfahrzeugs einhergehen. Oft läuft es aber nicht so ab, der Alte wird weiterverkauft.
Foto: stock.adobe.com © steftach
6. Alte Fahrzeuge können oft nachgerüstet werden
An diesem Punkt muss ein Unterschied zwischen „alten“ und „sehr alten“ Fahrzeugen gemacht werden. Insbesondere bei Benzinern existiert schon seit der Pflicht zum Einbau von Katalysatoren (das war 1984 im damaligen West-Deutschland der Fall) eine vergleichsweise hohe Sauberkeit der Abgase. Selbst, wer beispielsweise einen Wagen von Mitte der 1990er fährt – also nach rechtlichen Maßstäben fast einen Oldtimer – der erhält daher in aller Regel problemlos die grüne Feinstaubplakette.
Natürlich hat sich seitdem einiges getan; sowohl bei Benzinern als auch bei Dieselmotoren. Eines wird jedoch häufig ignoriert: Es existiert eine überraschend große Industrie, die diverse Produkte offeriert, um das Abgasverhalten älterer Autos zu optimieren.
Solange es sich nicht um ausgesprochene Exoten handelt, hat daher fast jeder Besitzer eines solchen Fahrzeugs die Möglichkeit, es sauberer und/oder verbrauchsärmer zu machen. So können beispielsweise viele Benziner auf Flüssiggas umgerüstet werden. Ebenso gibt es Katalysatoren, Kaltlaufregler und weitere Techniken. Tatsächlich etablieren sich derzeit Firmen, die nichts anderes tun, als alte Verbrenner mit modernen Elektromotoren auszurüsten.
Was gegen alte Fahrzeuge spricht
„[…] Klar ist aber, wenn man sich für ein neues Auto entscheidet, entscheidet man sich erst mal für ein umweltverträglicheres Auto in Sachen Abgasstufe. In Sachen Klimaschutz muss man halt schauen: Wie viel verbraucht das Auto tatsächlich weniger im Vergleich zum alten Auto. Und hierbei sind jeweils vor allen Dingen der Verbrauch des alten Autos und dessen reale Kraftstoffart, dann die Größe des neuen Autos und dessen Kraftstoffart sowie natürlich die jährliche Fahrleistung relevant.“
Diese Worte stammen von jemandem, der sich mit dem Thema auskennt: Helge Jahn vom Umweltbundesamt in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Wer die Worte aufmerksam liest, entdeckt darin eine wichtige Tatsache: In Sachen Abgasverhalten ist neu fast immer besser als alt. Wenngleich, wie bereits erwähnt, die Kluft gerade bei Benzinern nicht so groß ist, wie oftmals angenommen.
Ebenso lässt sich dem Interview noch eine Tatsache entnehmen: Angesichts diverser Faktoren können alte Autos in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz einem Neuwagen nicht das Wasser reichen. Doch welche Faktoren spielen hier eine Rolle?
7. Nachrüsten ist nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich
Warum bekommt man selbst auf dem aktuell sehr angespannten und hochpreisigen Gebrauchtwagenmarkt Fahrzeuge mit Dieselmotoren, die nur Euro 3, Euro 2 oder gar Euro 1 (keine Plakette) erreichen, zu Spottpreisen regelrecht nachgeworfen – sofern sie nicht exportiert werden? Der Grund ist simpel:
Klammert man einmal die (naturgemäß teure) Komplettumrüstung auf einen Elektroantrieb aus, dann gibt es bei alten Verbrennern stets eine Grenze dessen, was an Verbesserungen möglich ist. Wenn etwa ein Motor aufgrund seiner allgemeinen, unveränderlichen Bauweise einen bestimmten spezifischen Kraftstoffverbrauch und ein ebensolches Abgasverhalten hat, dann lässt beides sich ebenso wenig unter ein bestimmtes Niveau bringen wie der Luftwiderstand der Karosserie.
Ja, alte Fahrzeuge können durch Nachrüstungen durchaus besser werden. Zusammen mit dem geringeren Gewicht vielleicht sogar auf ein Niveau, auf dem sie weniger verbrauchen als ein zeitgenössisch schweres Auto. Speziell beim Abgasverhalten jedoch gibt es definitiv eine Grenze. Ebenso, wie ein Formel-1-Renner der 1980er trotz starkem Motor bei heutigen Rennen keine Chance hätte, wird ein PKW aus beispielsweise den frühen 00ern kein Saubermann wie sein Nach-Nachfolger von heute.

Man kann vieles nachrüsten, um die Umweltbilanz eines Altfahrzeugs zu verbessern. An irgendeinem Punkt wird jedoch sowohl eine technische als auch wirtschaftliche Grenze erreicht, hinter der sich nichts mehr verbessern lässt.
Foto: stock.adobe.com © ksch966
8. Eine ganze Ersatzteilindustrie nur für alte Modelle ist nicht ökologisch
Bislang haben wir nur das einzelne Auto betrachtet. Fakt ist: Es gibt nur noch wenige Profis, die wirklich jedes schadhafte Bauteil per Hand reparieren können – und selbst das niemals zu günstigen Preisen.
Zwischen Bremsbelägen, Austausch-Katalysatoren und jeder Menge anderer fahrzeugspezifischer Teile verursachen alte Fahrzeuge daher eine ziemliche Doppelbelastung. Nur für sie müssen ganze Fertigungsstraßen aufrechterhalten, Ersatzteile produziert werden – Dinge, die ersatzlos wegfallen würden, wären diese Autos im Recycling-Kreislauf verschwunden.
Dies soll aufzeigen, wie sehr der Weiterbetrieb eines alten Fahrzeugs in einem größeren Maßstab durchaus eine Bürde sein kann.
9. Je älter der Wagen, desto größer der Erhaltungsaufwand
Wer sich morgen im Autohaus einen brandneuen PKW abholt, der darf sich sicher sein, abgesehen von bei der Inspektion auszutauschenden Betriebsflüssigkeiten für gleich mehrere Jahre keinerlei Ersatzteile zu benötigen – sofern nicht etwas ungewöhnlich früh ausfällt oder ein Unfall in die Quere kommt.
Diese Tatsache macht es Neuwagen definitiv leichter, den Fußabdruck ihrer Produktion in den ersten Jahren abzuarbeiten. Umgekehrt steigt mit zunehmendem Alter und Laufleistung der Aufwand rapide an, um ein Auto auf der Straße zu halten. Wohl müssen Verschleißteile nicht häufiger ersetzt werden. Dafür fallen dann Dinge aufgrund von Alterungserscheinungen aus, die bei einem viel jüngeren Auto nicht relevant sind. Das kann in der Summe den Fußabdruck des Altfahrzeugs wiederum verschlechtern.

Wie oft wird das Auto überhaupt aus der Garage hervorgeholt? Das ist einer der wichtigsten Gradmesser, der darüber entscheidet, an welchem Punkt ein Neufahrzeug die ökologisch bessere Alternative wäre.
Foto: stock.adobe.com © Anze Furlan
Dreh- und Angelpunkt Jahreslaufleistung und Nutzungshäufigkeit
Was nun besser ist, hängt von zahlreichen Einzelfaktoren ab. Die beiden wichtigsten sind die Häufigkeit der Benutzung, die Anzahl von Kilometern, die mit dem Fahrzeug pro Jahr gefahren werden.
- Je intensiver ein Auto benutzt wird, desto stärker amortisieren sich speziell die beiden Faktoren Verbrauch und Abgasverhalten. Bedeutet, wer viel und häufig fährt, baut den Fußabdruck der Produktion eines Neufahrzeugs rasch ab. Dann summieren sich der (hoffentlich aufgrund der Modellauswahl) geringere Verbrauch und das stets bessere Abgasverhalten auf.
- Je weniger ein Auto hingegen genutzt wird, desto weniger relevant werden die besseren Daten eines neueren Fahrzeugs. Bei wie vielen Kilometern im Jahr die Grenze liegt, unterscheidet sich naturgemäß stark zwischen den Modellen. Tendenziell gilt jedoch: Unterhalb von etwa 10.000 Jahreskilometern, und sofern es sich um ein halbwegs modernes Altfahrzeug (Baujahr Benziner nicht vor zirka 1990, Diesel nicht vor zirka 2005) handelt, ist der alte Wagen meistens die ökologischere Alternative.
Dazu sei an dieser Stelle auf ein Tool des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg verwiesen. Es gestattet den Vergleich von Verbrennern, Hybriden und E-Autos bezogen auf das gesamte Fahrzeugleben.
Neben der reinen Fahrleistung müssen hierbei allerdings weitere Dinge beachtet werden. Erstens muss es sich stets um Erstfahrzeuge handeln.
Zweitens spielt es beim Austausch eine große Rolle, was mit dem alten Wagen geschieht. Wird das Auto an jemanden verkauft, der bislang noch gar kein Auto besaß, wird der Umwelt ein Bärendienst erwiesen – denn weil der vorherige Besitzer sich ein Neufahrzeug zulegt, steigt auf diese Weise die Zahl der weltweit vorhandenen Autos. Das heißt, wirklich nachhaltig wird es nur dann, wenn ein alter Wagen danach tatsächlich in die Schrottpresse wandert und möglichst vollständig recycelt wird.
Drittens ist es nötig, den (umwelt-)technischen Abstand zwischen Alt- und Neufahrzeug zu betrachten. Je näher das Altfahrzeug hinsichtlich Verbrauchs- und Abgasverhalten an einem gleichwertigen Neufahrzeug liegt, desto mehr dürfte man damit fahren, bevor ein Neuer die bessere Wahl wäre. Insofern können zwischen einem guten Benziner-Gebrauchten der späten 90er Jahre und einem nur mit ungeregeltem Kat versehenen Oldtimer aus Mitte der 80er durchaus Welten liegen.
Zusammenfassung und Fazit
Pauschale Antworten auf die Frage „neues Auto kaufen oder altes möglichst lange fahren?“ sind unmöglich. Nicht einmal dann, wenn es sich beim neuen Auto um ein reines Elektrofahrzeug handelt, das also lokal gar keine Abgase produziert. Sowohl das Klima als auch die gesamte Nachhaltigkeitsthematik müssen aus einem größeren Blickwinkel betrachtet werden.
Der enorme Fußabdruck, der bei der Herstellung eines Autos entsteht, muss erst einmal in der Folgezeit „abgefahren“ werden. Unter diesem Aspekt kann es die bessere Lösung sein, ein älteres Fahrzeug noch einige Jahre zu behalten. Insbesondere, wenn die reale Lücke von Verbrauch und Abgasausstoß zwischen beiden Modellen eher gering ist.
Irgendwann kommt bei jedem Fahrzeug und jedem Nutzungsprofil der Punkt, an dem es ungeachtet aller anderen Faktoren für Klima, Natur und Umwelt besser ist, auf einen modernen Wagen umzusteigen – und sei es nur deshalb, weil man so viel fährt, dass sich die Unterschiede im Verbrauch schon nach den ersten paar Tankfüllungen in gleich mehreren Litern bemerkbar machen.

